


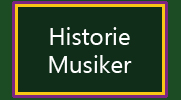

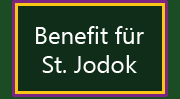


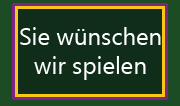
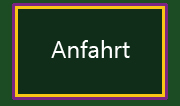
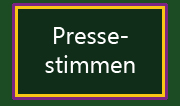

 |
|||||
 |
 |
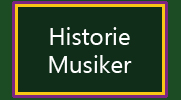 |
 |
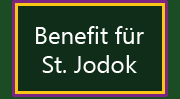 |
 |
 |
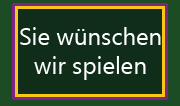 |
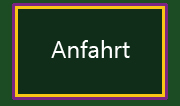 |
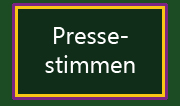 |
 |
|
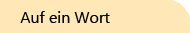 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
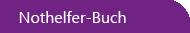 |
 |
 |
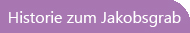 |
 |
Die drei Lebenden und drei Toten |
|
||||
| |
Nachdem
wir in den vergangenen Jahren mehrfach auf besondere
Ausstattungselemente der St.-Jodok-Kirche
aufmerksam machten, wollen wir diese
Reihe 2018 mit dem Wandbild der drei Lebenden und der drei Toten
fortsetzen. Erstmals können
wir uns dabei auf eine wissenschaftliche
Arbeit berufen, die 1908 von Karl Künstle mit dem Titel „Die Legende
der drei
Lebenden und der drei Toten und der Totentanz“ im Verlag Herder
erschienen ist. In diesem
Zusammenhang ist das Andenken an den im Februar
1908 verstorbenen Münsterpfarrer von Überlingen Dr. August Freiherr von
Rüpplin
anzumerken, der exponiert in der Widmung der Arbeit Erwähnung findet
und der
wohl maßgeblich an der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas
beteiligt
war. Auslöser der
Arbeit war die Freilegung der Wandmalereien in
der St.-Jodok-Kirche durch die Werkstatt Mezger in den Jahren 1902/03. |
 Bestandszeichnung Die drei Lebenden und drei Toten von Viktor Mezger, sen nach der Freilegung 1903 |
|
||
| |
|
Künstle geht
zunächst allgemein auf die Wandmalerei der
Gotik und Spätgotik im Bodenseeraum ein, bevor er auf die Bilder der
St.-Jodok-Kirche
näher aufmerksam macht. Zur Wandmalerei der drei Lebenden und drei
Toten
beschreibt er sinngemäß: ...Der unter
der Nothelferreihe angebrachte Bilderfries
scheint mit einer Kreuzigungsgruppe zu beginnen, von der aber mit
Sicherheit
nur noch Johannes zu erkennen ist. Daneben schreiten gen Westen drei
Fürstengestalten; die beiden vordersten tragen lange Brokatmäntel, die
hintere
ein eng anliegendes, bis fast an die Knie reichendes Wams; die mittlere
hält in
der Rechten ein Lilienzepter; auf der Faust des zweiten und dritten
Fürsten
sitzt je ein Falke. Alle drei tragen barettartige Hauben. Der halb
geöffnete
Mund und die starr vorwärts gerichteten Augen sollen Überraschung und
Schrecken
ausdrücken. Diese Seelenstimmung ist begreiflich, denn es begegnen den
drei
Fürsten drei Tote, über deren abgemagerten Gestalten ein loser Mantel
hängt.
Bei dem ersten Toten ist leider die obere Partie bis zur Brust mit dem
Verputz
abgefallen, während die beiden anderen ganz intakt sind. Diese tragen
mit
weißen und roten Schlangen bedeckte Kronen über den totenkopfartigen
Gesichtern. Die sechs Gestalten und auch die Kreuzigungsgruppe heben
sich von
einem dunkelgrünen Teppich ab; der Zwischenraum zwischen diesem und der
Borte,
die den Bildfries nach oben abgrenzt, ist mit verschlungenen
Schriftbändern
ausgefüllt, deren Text sich aber nicht mehr entziffern lässt.... Zu ergänzen
wäre noch, dass sich der angesprochene Teppich
rot und mit einfach ausgefüllten Ornamenten an den beschriebenen Fries
nach
unten bis ans obere Ende der Sitzbänke anschließt. Die ganze
Darstellung hat
die Anmutung einer Tapisserie. Nach weiteren Ausführungen geht er auf den Schriftzug ein, der in Wortfahnen über den Personengruppen sinngemäß lautet: Wir waren, was
ihr seid; Doch kommen
wird die Zeit, Und kommen wird
sie euch geschwind, Wo ihr sein werdet, was wir sind. Künstle
verweist auf den vorchristlichen Ursprung des
Textes, der durch die arabische Spruchpoesie im 10. oder 11.
Jahrhundert nach
Spanien gelangte und von dort durch den in dieser Zeit reichen
literarischen
Austausch zwischen den Religionen in Mitteleuropa Verbreitung fand. Weiter belegt
er und führt zahlreiche Beispiele an, wie sich
aus dem Spruch ganz unterschiedliche dramatische Legenden formten,
die-religiös
mahnend und motivierend- sich im Mittelalter großer Beliebtheit
erfreuen. Zunächst als
Illustrationen literarischer Formen
verarbeitet, hat die Legende ihren Ursprung in Frankreich und findet
sich im
13. bis zum 15. Jahrhundert auch in monumentaler Darstellung besonders
in
Nordfrankreich, weniger in England, Italien, den Niederlanden oder in
Deutschland wieder.Bevor Künstle seine Ausführungen über den von ihm
mit dem
Wandbild in Verbindung gebrachten Totentanz weiter vorsetzt, stellt er
sich die
Frage, welchem Umstand es zu verdanken ist, dass die Wandbilder aus der
Gründungszeit
der St.-Jodok-Kirche: Galgenwunder, die drei Lebenden und Toten, der
nur noch
schwer zu erkennende Wandfries auf der nördlichen Chorwand, eine
Marienlegende
und das Wandbild der heiligen Kümmernis, rechts unter der Chorempore,
in
Zusammenhang stehen. Die dem Wandbild in Überlingen zugrunde liegende Legende weist in Form und Darstellung nach Frankreich. Drei hochgestellte junge Männer treten in Dialog mit drei Toten ihres Standes, dargestellt durch drei bekrönte Skelette. Die Toten mahnen das lasterhafte irdische Leben an und weisen auf die Vergänglichkeit des Seins hin. Die angefügte Kreuzgruppe versinnbildlicht die Erlösung der begangenen Sünden durch Jesus Christus und soll Hoffnung und Trost spenden.
|
 Münsterpfarrer von Überlingen Dr. August Freiherr von Rüpplin, 1908  Wandbild Die drei lebenden und drei Toten St.-Jodok-Kirche, Überlingen |
||
| Schwerttanz und Totentanz |
|||||
|
Unvermittelt stellt Künstle aufgrund der
Darstellung der
drei Lebenden und der drei Toten eine Verbindung zur lokalen Tradition
des
Schwerttanzes her. Dabei schildert er die Aufführungspraxis des
Schwerttanzes
zur Fastnacht. Wie damals üblich bestand die Kompanie nur aus Bürgern
des nahen
Umfeldes der St.-Jodok-Kirche. Er zieht erstaunliche Parallelen zum Dorf
Pont de Cervières
im Departement Hautes-Alpes, Frankreich, in dem am Gedenktag des
heiligen
Rochus, dem 16. August, ein Schwerttanz, Bacchu-ber genannt, aufgeführt
wird,
um die Fürsprache des Heiligen gegen die Pest zu bewirken. Interessant
ist,
dass die Schwertfiguren der Tänzer trotz der weiten räumlichen Trennung
große
Gemeinsamkeiten aufweisen. |
 |
Schwerttanz Cervières, Frankreich |
|||
| |
|
Sollten das Überlinger Wandbild und der
Schwerttanz seiner
Bürger eine ursprünglich ähnliche Bedeutung haben? Zu Beginn des
letzten
Jahrhunderts versammelten sich die Überlinger Schwerttänzer an
Fastnacht, noch
bevor sie den Waffentanz antraten, in der St.-Jodok-Kirche, um unter
dem
Wandbild der drei Lebenden und der drei Toten die heilige Messe zu
empfangen. Nicht weiter geht Künstle auf die Stellung
des Hänsele im
Schwerttanz ein. Er, der nach aktueller Lesart als Sinnbild des Todes
und des
gesellschaftlich Geächteten fungiert, war wohl nur während der
Fastnacht
geduldet und durfte sich auch nur da verlautbaren. Der Zusammenhang zwischen Pest, Schwerttanz, Hänsele, Fastnacht und Totentanz wäre wert, tiefer ergründet zu werden.
|
 |
Schwerttanz Überlingen |
|
|
|
Impressum/ Datenschutz/ Widerrufsrecht | ||||